Die Grenzen der OEE – was die Kennzahl nicht misst
Die Grenzen der OEE, was die Kennzahl nicht misst
Die Overall Equipment Effectiveness (OEE) gilt als Standardkennzahl, wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit von Maschinen und Anlagen zu bewerten. Sie kombiniert Verfügbarkeit, Leistung und Qualität zu einem Wert und macht damit sichtbar, wie effektiv eine Produktion tatsächlich arbeitet.
Trotz ihrer weiten Verbreitung ist die OEE jedoch kein vollständiges Abbild industrieller Effizienz. Wie jede Kennzahl beschreibt sie nur einen bestimmten Ausschnitt der Realität, und kann, wenn sie isoliert betrachtet wird, zu falschen Schlüssen führen.
Im Folgenden geht es um die wichtigsten methodischen und praktischen Grenzen der OEE, und darum, wie sie im richtigen Kontext verstanden werden sollte.
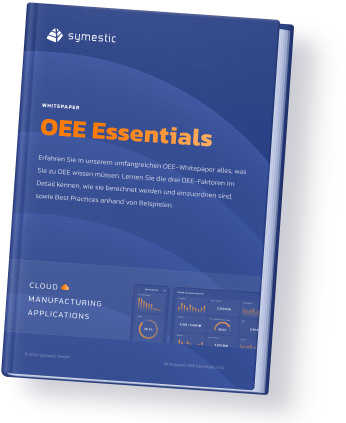
OEE misst Effizienz, aber keine Effektivität
Die OEE beantwortet im Kern die Frage, wie gut vorhandene Ressourcen genutzt werden. Sie sagt aber nichts darüber aus, ob diese Nutzung sinnvoll oder wirtschaftlich ist.
Eine Anlage kann eine OEE von 90 % erreichen und trotzdem unprofitabel laufen, etwa, wenn sie ein Produkt herstellt, das sich schlecht verkauft oder zu hohen Materialkosten produziert wird.
Kurz gesagt, OEE misst Effizienz, nicht Effektivität.
Sie ist ein operativer Indikator, kein strategischer. Für Entscheidungen über Produktmix, Kapazitätsplanung oder Rentabilität muss sie mit wirtschaftlichen Kennzahlen kombiniert werden.
Welche wirtschaftlichen Effekte sich durch eine gezielte Steigerung der OEE tatsächlich ergeben, zeigt unser Beitrag OEE und Produktionskosten.
Keine Aussage zur Kapazitätsnutzung oder Auftragslage
Die OEE bezieht sich ausschließlich auf die geplante Produktionszeit. Stunden, in denen eine Anlage stillsteht, weil kein Auftrag vorliegt oder Material fehlt, tauchen in der Berechnung nicht auf.
Eine Maschine kann also mit 85 % OEE bewertet werden, obwohl sie 16 von 24 Stunden gar nicht läuft.
Um die Gesamtauslastung einer Ressource zu bewerten, ist TEEP (Total Effective Equipment Performance) die passendere Größe. Sie ergänzt die OEE um die ungenutzte Kalenderzeit und zeigt, wie stark eine Anlage tatsächlich genutzt wird.
Menschliche und organisatorische Faktoren bleiben außen vor
Die OEE ist eine Maschinenkennzahl, sie misst keine menschlichen oder organisatorischen Einflüsse.
Ob eine Schicht gut funktioniert, hängt aber oft an Faktoren wie Personalbesetzung, Qualifikation, Kommunikation oder Motivation.
Zwei Linien mit identischer technischer OEE können wirtschaftlich völlig unterschiedlich performen, wenn das Team an einer Anlage eingespielter arbeitet.
Kennzahlen wie OLE (Overall Labor Effectiveness) oder Workforce Efficiency ergänzen hier die fehlende Perspektive und machen das Zusammenspiel von Mensch und Maschine bewertbar.
OEE ist produktabhängig
OEE setzt die aktuelle Leistung ins Verhältnis zu einem idealen Zustand, dieser Idealwert hängt jedoch vom Produkt und Prozess ab.
In einer Fertigung mit vielen Varianten ändern sich Taktzeiten, Werkzeuggeometrien oder Materialeigenschaften ständig.
Dadurch lassen sich OEE-Werte zwischen Produkten oder Linien kaum direkt vergleichen, wenn die Basisdaten nicht harmonisiert sind.
Eine sinnvolle Bewertung erfordert daher eine Normalisierung, etwa durch Produktfamilien, Prozesscluster oder gewichtete Mittelwerte.
Qualitätsverluste erscheinen oft zu spät
Der Qualitätsfaktor in der OEE basiert in vielen Betrieben auf End-of-Line-Prüfungen.
Fehler, die erst am Ende eines Prozesses sichtbar werden, fließen daher verzögert ein.
Das kann zu einer Scheingenauigkeit führen, der OEE-Wert steigt, während sich gleichzeitig der Ausschuss erhöht.
Erst wenn Qualitätsdaten inline und in Echtzeit erfasst werden, etwa über Prozessüberwachung oder SPC (Statistical Process Control), spiegelt die Kennzahl die tatsächliche Prozessfähigkeit wider.
Andernfalls beschreibt sie vor allem die Ergebnisqualität, nicht die Prozessqualität.
Energie- und Ressourceneffizienz sind nicht enthalten
Die OEE betrachtet Zeit und Stückzahlen, aber keine Ressourcenverbräuche.
Eine Linie kann also eine hohe OEE haben und trotzdem überdurchschnittlich viel Energie oder Rohmaterial benötigen.
In Zeiten von Energieknappheit und Nachhaltigkeitszielen wird das zunehmend relevant.
Erweiterte Ansätze wie Energy-Adjusted OEE oder OEE+Energy beziehen den Energieeinsatz pro Gutteil ein und erlauben so eine ökonomisch-ökologische Bewertung der Produktivität.
Keine Aussage über Termintreue oder Durchsatz
OEE misst den Zustand der Anlage, nicht den Fluss des gesamten Systems.
Eine Linie mit 75 % OEE kann alle Aufträge rechtzeitig liefern, wenn genügend Kapazität vorhanden ist.
Umgekehrt kann eine mit 90 % OEE zu Verzögerungen führen, wenn sie die falschen Produkte produziert.
Für wertstromorientierte Analysen sind daher Kennzahlen wie Throughput, Lead Time oder On-Time Delivery (OTD) besser geeignet.
Sie betrachten nicht die einzelne Maschine, sondern den gesamten Produktionsfluss.
Vergleichbarkeit zwischen Standorten ist begrenzt
OEE-Werte sind stark abhängig von der Erfassungsmethodik.
Schon kleine Unterschiede in der Klassifikation, etwa, ob ein Rüstvorgang als geplanter oder ungeplanter Stopp zählt, können große Abweichungen erzeugen.
Selbst in Konzernen mit zentralem MES-System sind OEE-Daten daher nicht ohne Weiteres vergleichbar.
Nur eine einheitliche Definition, klare Datenstrukturen und konsequente Nutzung derselben Messlogik schaffen belastbare Vergleiche.
Fazit, eine notwendige, aber begrenzte Kennzahl
Die OEE ist ein unverzichtbares Werkzeug, um Verluste sichtbar zu machen und Prozesse datenbasiert zu verbessern.
Doch sie ist kein Maßstab für Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit oder Wettbewerbsfähigkeit.
Ihre Stärke liegt in der Transparenz, ihre Schwäche in der Einseitigkeit.
Wer sie sinnvoll nutzt, kennt ihre Grenzen, und ergänzt sie um weitere Größen wie TEEP (Gesamtnutzung), OAE (Asset-Effektivität), OLE (Mensch-Maschine-Leistung), SPC (Prozessfähigkeit) oder Energiekennzahlen.
Erst im Zusammenspiel dieser Werte entsteht ein vollständiges Bild industrieller Leistungsfähigkeit.
Exklusives Whitepaper
Lernen Sie die modernsten Ansätze der Industrie 4.0, die Sie in Ihrer Produktion schon morgen umsetzen können, um innerhalb von 4 Wochen Ihre Kosten um gut 20% zu reduzieren.
mehr erfahren




